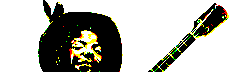
Authentisches Notenmaterial aus der Zeit der frühen Bigbands ist eine einzigartige Quelle für jeden Musiker, der sich ernsthaft mit dieser Musikart beschäftigt. Der Anfänger, insbesondere der Banjospieler hat dabei etliche Probleme zu bewältigen. Ihm soll hier geholfen werden.
![]() Das
Notenmaterial, mit dem ich mich mittlerweile seit 15 Jahren in diversen
Orchestern befasse, stammt aus der Zeit von 1900 - 1940. Der Schwerpunkt liegt
aber ganz klar auf den späten 20er Jahren. Geographisch gesehen stammen die
Noten überwiegend aus Amerika und Deutschland. Aber auch England und das übrige
Europa sind gut vertreten. Das meiste sind sogenannte Stock-Arrangements, das
sind als Massenware verkaufte Druckarrangements, gewissermaßen Standardvorlagen,
aus denen sich durch den Einbau von Solochorussen passable Interpretationen
eines Stückes schaffen lassen.
Das
Notenmaterial, mit dem ich mich mittlerweile seit 15 Jahren in diversen
Orchestern befasse, stammt aus der Zeit von 1900 - 1940. Der Schwerpunkt liegt
aber ganz klar auf den späten 20er Jahren. Geographisch gesehen stammen die
Noten überwiegend aus Amerika und Deutschland. Aber auch England und das übrige
Europa sind gut vertreten. Das meiste sind sogenannte Stock-Arrangements, das
sind als Massenware verkaufte Druckarrangements, gewissermaßen Standardvorlagen,
aus denen sich durch den Einbau von Solochorussen passable Interpretationen
eines Stückes schaffen lassen.
![]() Dem
Zeitrahmen entspricht dann auch die stilistische Spanne, sie reicht vom Ragtime
der Jahrhundertwende bis zu deutschen Swingversuchen aus der Nazizeit. Es
handelt sich im Wesentlichen um Hot Dance Music, jene lebhafte und jazzige
Variante der Tanzmusik, die als musikalische Untermalung für immer neue
sportliche Verrenkungen wie Charleston oder Black Bottom diente. Daneben stehen
echte Jazzarrangements und Filmmusik. In jedem Fall handelt es sich um
Bandarrangements, d.h. die Banjostimme ist Teil eines Gesamtklangs.
Dem
Zeitrahmen entspricht dann auch die stilistische Spanne, sie reicht vom Ragtime
der Jahrhundertwende bis zu deutschen Swingversuchen aus der Nazizeit. Es
handelt sich im Wesentlichen um Hot Dance Music, jene lebhafte und jazzige
Variante der Tanzmusik, die als musikalische Untermalung für immer neue
sportliche Verrenkungen wie Charleston oder Black Bottom diente. Daneben stehen
echte Jazzarrangements und Filmmusik. In jedem Fall handelt es sich um
Bandarrangements, d.h. die Banjostimme ist Teil eines Gesamtklangs.
![]() Wie
kommt man eigentlich dazu, sich ausgerechnet mit dieser Art von "Klassik" zu
befassen? Aus Selbstbeobachtung und Gesprächen mit Kollegen vermute ich, dass
wir einen guten Teil der Motivation unserem seit Urzeiten angeborenen
Sammeltrieb verdanken. Es macht einfach Spaß, dieselben Notenblätter zu besitzen
oder zumindest zu verwenden, vor denen auch schon unsere großen Vorbilder Mike
Pingitore oder Harry Reser gesessen haben. Dazu kommt, dass die Stücke, wenn sie
von der Band gespielt werden, wirklich genauso klingen wie wir sie von alten
Schellacks im Ohr haben. Und Ellingtons East St. Louis Toodle-O in voller
Besetzung im Originalarrangement zu spielen ist einfach ein Erlebnis! Neben
dieser Suche nach dem Originalklang steht - zumindest bei mir - noch der
Anspruch, auf meinem Instrument besser zu werden. Einige Changes habe ich erst
auf diesem Weg gelernt, die wären mir als Dixie-Musiker nie in den Sinn
gekommen. Und bei dem einen oder anderen kommen vielleicht sogar noch
Erinnerungen an den Opa oder Onkel dazu, der auch schon dieses Hobby gepflegt
hatte.
Wie
kommt man eigentlich dazu, sich ausgerechnet mit dieser Art von "Klassik" zu
befassen? Aus Selbstbeobachtung und Gesprächen mit Kollegen vermute ich, dass
wir einen guten Teil der Motivation unserem seit Urzeiten angeborenen
Sammeltrieb verdanken. Es macht einfach Spaß, dieselben Notenblätter zu besitzen
oder zumindest zu verwenden, vor denen auch schon unsere großen Vorbilder Mike
Pingitore oder Harry Reser gesessen haben. Dazu kommt, dass die Stücke, wenn sie
von der Band gespielt werden, wirklich genauso klingen wie wir sie von alten
Schellacks im Ohr haben. Und Ellingtons East St. Louis Toodle-O in voller
Besetzung im Originalarrangement zu spielen ist einfach ein Erlebnis! Neben
dieser Suche nach dem Originalklang steht - zumindest bei mir - noch der
Anspruch, auf meinem Instrument besser zu werden. Einige Changes habe ich erst
auf diesem Weg gelernt, die wären mir als Dixie-Musiker nie in den Sinn
gekommen. Und bei dem einen oder anderen kommen vielleicht sogar noch
Erinnerungen an den Opa oder Onkel dazu, der auch schon dieses Hobby gepflegt
hatte.
 Was
man da als Musiker vorgelegt bekommt, ist allerdings manchmal schon eine
Zumutung. Nicht nur, dass selten alle Instrumente in der Mappe enthalten sind.
Meist sind die ursprünglich gefalteten Seiten inzwischen auseinander gefallen
und völlig zerfleddert. Als Banjospieler hat man ja in der Regel nur 1- 2 Seiten
zu ordnen, der arme Pianist muss sich aber mit bis zu 7 Seiten
auseinandersetzen. Dann prangen auf den kostbaren Noten diverse Stempel und
Nummern früherer Eigentümer. Der Ablauf wurde mehrfach geändert und die neue
Spielweise jeweils dick markiert oder ganze Passagen durchgestrichen. Was noch
zu lesen ist, braucht keineswegs richtig zu sein, immer wieder tauchen Fehler
auf, die beim Kopieren der Noten von der Partitur entstanden sind. Einer unserer
Saxofonisten musste sich einmal lange schief anschauen lassen, ehe die Ursache
für seine fremdartigen Töne gefunden war: der Verkäufer hatte kurzerhand die
fehlenden Teile des Arrangements mit einem anderen(!) Arrangement desselben
Stückes aus seinen Beständen aufgefüllt.
Was
man da als Musiker vorgelegt bekommt, ist allerdings manchmal schon eine
Zumutung. Nicht nur, dass selten alle Instrumente in der Mappe enthalten sind.
Meist sind die ursprünglich gefalteten Seiten inzwischen auseinander gefallen
und völlig zerfleddert. Als Banjospieler hat man ja in der Regel nur 1- 2 Seiten
zu ordnen, der arme Pianist muss sich aber mit bis zu 7 Seiten
auseinandersetzen. Dann prangen auf den kostbaren Noten diverse Stempel und
Nummern früherer Eigentümer. Der Ablauf wurde mehrfach geändert und die neue
Spielweise jeweils dick markiert oder ganze Passagen durchgestrichen. Was noch
zu lesen ist, braucht keineswegs richtig zu sein, immer wieder tauchen Fehler
auf, die beim Kopieren der Noten von der Partitur entstanden sind. Einer unserer
Saxofonisten musste sich einmal lange schief anschauen lassen, ehe die Ursache
für seine fremdartigen Töne gefunden war: der Verkäufer hatte kurzerhand die
fehlenden Teile des Arrangements mit einem anderen(!) Arrangement desselben
Stückes aus seinen Beständen aufgefüllt.
![]() Fehlende
Stimmen lassen sich notdürftig aus der hoffentlich vorhandenen Klavierpartitur
ergänzen. Besser ist es, von Sammlern oder im Tausch mit Gleichgesinnten Kopien
zu besorgen. Die Stücke klingen von einer Photokopie gespielt Gott sei Dank
genau so gut wie vom Original. Überhaupt empfehle ich, die Originale mit einem
guten Kopierer zu kopieren und danach mit der Kopie zu arbeiten. Nicht nur, dass
man dann ungeniert eigene Modifikationen reinschreiben darf, auch die Lesbarkeit
der Noten gewinnt durch eine Kopie. Das liegt daran, dass moderne Kopierer die
gelblich braunen Farbtöne des alten Papiers einfach nicht wahrnehmen und statt
dessen reinstes Weiß reproduzieren. Vor dem Kopieren kann man noch alle mit
Bleistift nachträglich angebrachten Bemerkungen aus den Originalen radieren.
Tintenspuren und Stempel lassen sich mit Tipp-Ex beseitigen. Auf
Ausnahmen
von dieser Regel komme ich noch zu sprechen. Die so entstandenen Kopien werden
sodann in der richtigen Reihenfolge wieder zu faltbaren Blättern
zusammengeklebt, sofern man von Doppelseiten nicht gleich DIN A3 Kopien
anfertigen konnte.
Fehlende
Stimmen lassen sich notdürftig aus der hoffentlich vorhandenen Klavierpartitur
ergänzen. Besser ist es, von Sammlern oder im Tausch mit Gleichgesinnten Kopien
zu besorgen. Die Stücke klingen von einer Photokopie gespielt Gott sei Dank
genau so gut wie vom Original. Überhaupt empfehle ich, die Originale mit einem
guten Kopierer zu kopieren und danach mit der Kopie zu arbeiten. Nicht nur, dass
man dann ungeniert eigene Modifikationen reinschreiben darf, auch die Lesbarkeit
der Noten gewinnt durch eine Kopie. Das liegt daran, dass moderne Kopierer die
gelblich braunen Farbtöne des alten Papiers einfach nicht wahrnehmen und statt
dessen reinstes Weiß reproduzieren. Vor dem Kopieren kann man noch alle mit
Bleistift nachträglich angebrachten Bemerkungen aus den Originalen radieren.
Tintenspuren und Stempel lassen sich mit Tipp-Ex beseitigen. Auf
Ausnahmen
von dieser Regel komme ich noch zu sprechen. Die so entstandenen Kopien werden
sodann in der richtigen Reihenfolge wieder zu faltbaren Blättern
zusammengeklebt, sofern man von Doppelseiten nicht gleich DIN A3 Kopien
anfertigen konnte.
![]() Speziell
der Banjospieler wird seine Noten in recht unterschiedlicher Form auf dem Pult
vorfinden. Der Normalfall sind Noten für das Tenorbanjo. Manchmal steht auch
Mandola drüber. Selbst Gitarrenoten mit dem Aufdruck Banjo habe ich schon
gesehen. Die aus unseren Harmoniebüchern gewohnte Notierung als Folge von
Speziell
der Banjospieler wird seine Noten in recht unterschiedlicher Form auf dem Pult
vorfinden. Der Normalfall sind Noten für das Tenorbanjo. Manchmal steht auch
Mandola drüber. Selbst Gitarrenoten mit dem Aufdruck Banjo habe ich schon
gesehen. Die aus unseren Harmoniebüchern gewohnte Notierung als Folge von
 Akkordsymbolen
(Bb, F7 usw.)
war in den frühen Zwanzigern eher die Ausnahme. Harry Reser & Co. waren eben des
Notenlesens mächtig. Glücklicherweise finden sich zusätzlich über oder unter den
Notenlinien manchmal noch die entsprechenden Symbole für "Legastheniker".
Akkordsymbolen
(Bb, F7 usw.)
war in den frühen Zwanzigern eher die Ausnahme. Harry Reser & Co. waren eben des
Notenlesens mächtig. Glücklicherweise finden sich zusätzlich über oder unter den
Notenlinien manchmal noch die entsprechenden Symbole für "Legastheniker".
![]() Wer
will, kann sich diese selber drüber schreiben, allerdings wird’s dann schon mal
eng auf dem Blatt. Aber Vorsicht, selbst die Akkordsymbole heißen nicht immer so
wie wir erwarten. Ein Fdim ist z.B. unser
F0 und Bbmi
oder einfach nur Bb- bedeutet hierzulande
B-moll, während Baug unseren H+
Akkord bezeichnet. Was die eigentlichen Noten betrifft: auch die sehen ungewohnt
aus. Während es in der Banjoliteratur üblich ist, in Octava zu notieren,
sind die Noten des Banjospielers in der Band fast immer klingend notiert und
müssen gewissermaßen eine Oktave höher als vom Lehrbuch gewohnt gespielt werden.
Genau das ist übrigens gemeint, wenn über den Noten die Anweisung actual
pitch steht. Also keine Panik, wenn mal Noten unter dem tiefen
C
auftauchen, keiner muss deshalb umstimmen. Eine weitere Besonderheit ist, dass
die Akkorde meist nur mit drei Noten ausgeschrieben sind. Das führt nicht selten
dazu, dass der Akkord aus dem Notenbild nicht eindeutig zu bestimmen ist. Denn
was im folgenden Beispiel aussieht wie ein F7
Akkord, kann ja genauso gut ein C0 oder
Eb0
sein. Hier hilft nur, die Bassstimme oder die Pianopartitur zu Rate zu ziehen.
Wer
will, kann sich diese selber drüber schreiben, allerdings wird’s dann schon mal
eng auf dem Blatt. Aber Vorsicht, selbst die Akkordsymbole heißen nicht immer so
wie wir erwarten. Ein Fdim ist z.B. unser
F0 und Bbmi
oder einfach nur Bb- bedeutet hierzulande
B-moll, während Baug unseren H+
Akkord bezeichnet. Was die eigentlichen Noten betrifft: auch die sehen ungewohnt
aus. Während es in der Banjoliteratur üblich ist, in Octava zu notieren,
sind die Noten des Banjospielers in der Band fast immer klingend notiert und
müssen gewissermaßen eine Oktave höher als vom Lehrbuch gewohnt gespielt werden.
Genau das ist übrigens gemeint, wenn über den Noten die Anweisung actual
pitch steht. Also keine Panik, wenn mal Noten unter dem tiefen
C
auftauchen, keiner muss deshalb umstimmen. Eine weitere Besonderheit ist, dass
die Akkorde meist nur mit drei Noten ausgeschrieben sind. Das führt nicht selten
dazu, dass der Akkord aus dem Notenbild nicht eindeutig zu bestimmen ist. Denn
was im folgenden Beispiel aussieht wie ein F7
Akkord, kann ja genauso gut ein C0 oder
Eb0
sein. Hier hilft nur, die Bassstimme oder die Pianopartitur zu Rate zu ziehen.

![]() Der
Ablauf, d.h. die Reihenfolge, in der die einzelnen Teile des Notenblatts zu
spielen sind, ist zumindest in meiner Band ein steter Quell von Fehlern und
Missverständnissen. Es ist ja auch nicht einfach, zumal häufig die
aufgeschriebene Reihenfolge innerhalb der Band geändert oder umgestellt wird.
Dass diese Praxis nicht neu ist, lässt sich unschwer beim Vergleich der Noten
mit den alten Einspielungen auf Schellacks nachweisen. Und die erwähnten
Anmerkungen der Vorbesitzer auf den Notenblättern belegen das ebenfalls.
Trotzdem gibt es ein Standardschema, das in der Mehrzahl der Fälle zutrifft und
an dem sich der Einsteiger oder Aushilfsmusiker fürs Erste orientieren kann:
Der
Ablauf, d.h. die Reihenfolge, in der die einzelnen Teile des Notenblatts zu
spielen sind, ist zumindest in meiner Band ein steter Quell von Fehlern und
Missverständnissen. Es ist ja auch nicht einfach, zumal häufig die
aufgeschriebene Reihenfolge innerhalb der Band geändert oder umgestellt wird.
Dass diese Praxis nicht neu ist, lässt sich unschwer beim Vergleich der Noten
mit den alten Einspielungen auf Schellacks nachweisen. Und die erwähnten
Anmerkungen der Vorbesitzer auf den Notenblättern belegen das ebenfalls.
Trotzdem gibt es ein Standardschema, das in der Mehrzahl der Fälle zutrifft und
an dem sich der Einsteiger oder Aushilfsmusiker fürs Erste orientieren kann:

![]() Nach
Intro und Versen werden zwei oder mehr Chorusse wiederholt, ehe mit einem
"Special Chorus", meist als rhythmisch variierte Version oder nach einer
Modulation in einer anderen Tonart gestaltet, fortgefahren wird. Am Ende
angekommen, sind italienische und englische Sprachkenntnisse gefragt. Dal
segno once al fine heißt, wir sollen noch mal vom Zeichen weg spielen, aber
daran ohne Wiederholung gleich die mit fine bezeichneten Takte
anschließen, womit das Stück endet. Als Zeichen für den Rücksprung findet man in
der Regel eines der Symbole
Nach
Intro und Versen werden zwei oder mehr Chorusse wiederholt, ehe mit einem
"Special Chorus", meist als rhythmisch variierte Version oder nach einer
Modulation in einer anderen Tonart gestaltet, fortgefahren wird. Am Ende
angekommen, sind italienische und englische Sprachkenntnisse gefragt. Dal
segno once al fine heißt, wir sollen noch mal vom Zeichen weg spielen, aber
daran ohne Wiederholung gleich die mit fine bezeichneten Takte
anschließen, womit das Stück endet. Als Zeichen für den Rücksprung findet man in
der Regel eines der Symbole
![]() ,
, ![]() oder
oder ![]()
![]() Ich
gehe mal davon aus, dass die Mehrzahl der Banjospieler nicht in der Lage ist,
die erwähnten Noten ohne zusätzliche Akkordsymbole vom Blatt zu spielen. Selbst
die Profis die ich kenne, schaffen das allenfalls für Gitarre fehlerfrei. Erste
Hilfe sind daher die Akkordsymbole, die man in einer ruhigen Minute anhand der
Bassstimme selber herausfinden und eintragen kann. Wo das noch nicht reicht,
etwa weil recht ungewöhnliche Synkopen auftauchen, hilft es ungemein, sich das
Ganze mal vorspielen zu lassen. Das kann eine Aufnahme desselben Arrangements
sein oder eine des Pianofortes kundige Freundin, notfalls tut’s sogar ein
Computer. Selbst wenn bei der häuslichen Vorbereitung alles gelang, beim
Auftritt droht neues Ungemach. Einmal kurz abgelenkt, schon weiß der arme
Musiker nicht mehr, wo in den Noten er sich befindet. Daher sollte man sich
angewöhnen, die Griffe "blind" zu spielen, d.h. man sollte die Umsetzung der
Noten nicht ständig durch einen Blick aufs Griffbrett kontrollieren müssen. Ein
weiterer Trick ist das "Vorauslesen". Dabei hat man immer schon den nächsten
oder übernächsten Takt im Blick und weiß somit rechtzeitig, wann ein Sprung auf
eine andere Stelle in den Noten kommt und kann nach dem Ziel Ausschau halten. A
propos Sprung: Sprungziele wie die oben gezeigten oder fine
male ich mit einem Textmarker blau an. Dann sind sie sofort zu sehen. Das sonst
übliche Gelb ist wegen der Kunstlichtbeleuchtung auf der Bühne hierfür
schlechter geeignet. Handelt es sich um häufig gespielte Stücke oder kommt ein
Banjosolo darin vor, empfehle ich, das Stück gleich auswendig zu lernen. So kann
man sich nach dem Solo auch mal für den Applaus bedanken und versinkt nicht
sofort wieder starren Blicks in den Noten. Ein letzter Tipp für windige
Auftritte im Freien: Wäscheklammern! Ein reaktionsschneller Trompeter kann
vielleicht seine Noten mit einer Hand festhalten, der Banjospieler muss als
"vollbeschäftigter" Musiker rechtzeitig vorsorgen.
Ich
gehe mal davon aus, dass die Mehrzahl der Banjospieler nicht in der Lage ist,
die erwähnten Noten ohne zusätzliche Akkordsymbole vom Blatt zu spielen. Selbst
die Profis die ich kenne, schaffen das allenfalls für Gitarre fehlerfrei. Erste
Hilfe sind daher die Akkordsymbole, die man in einer ruhigen Minute anhand der
Bassstimme selber herausfinden und eintragen kann. Wo das noch nicht reicht,
etwa weil recht ungewöhnliche Synkopen auftauchen, hilft es ungemein, sich das
Ganze mal vorspielen zu lassen. Das kann eine Aufnahme desselben Arrangements
sein oder eine des Pianofortes kundige Freundin, notfalls tut’s sogar ein
Computer. Selbst wenn bei der häuslichen Vorbereitung alles gelang, beim
Auftritt droht neues Ungemach. Einmal kurz abgelenkt, schon weiß der arme
Musiker nicht mehr, wo in den Noten er sich befindet. Daher sollte man sich
angewöhnen, die Griffe "blind" zu spielen, d.h. man sollte die Umsetzung der
Noten nicht ständig durch einen Blick aufs Griffbrett kontrollieren müssen. Ein
weiterer Trick ist das "Vorauslesen". Dabei hat man immer schon den nächsten
oder übernächsten Takt im Blick und weiß somit rechtzeitig, wann ein Sprung auf
eine andere Stelle in den Noten kommt und kann nach dem Ziel Ausschau halten. A
propos Sprung: Sprungziele wie die oben gezeigten oder fine
male ich mit einem Textmarker blau an. Dann sind sie sofort zu sehen. Das sonst
übliche Gelb ist wegen der Kunstlichtbeleuchtung auf der Bühne hierfür
schlechter geeignet. Handelt es sich um häufig gespielte Stücke oder kommt ein
Banjosolo darin vor, empfehle ich, das Stück gleich auswendig zu lernen. So kann
man sich nach dem Solo auch mal für den Applaus bedanken und versinkt nicht
sofort wieder starren Blicks in den Noten. Ein letzter Tipp für windige
Auftritte im Freien: Wäscheklammern! Ein reaktionsschneller Trompeter kann
vielleicht seine Noten mit einer Hand festhalten, der Banjospieler muss als
"vollbeschäftigter" Musiker rechtzeitig vorsorgen.
 Als
Bandmusiker steht man nicht alleine. Auch die Aushilfen sind auf Noten
angewiesen, mehr noch als der Stammspieler, sie sehen das Stück vielleicht zum
ersten Mal und müssen es quasi vom Blatt spielen. Ein paar Dinge gehören daher
einfach zum guten Ton, schließlich sind wir ja auch Aushilfe in anderen
Orchestern. Dazu zählt in erster Linie, dass alle Abweichungen in die
Notenblätter eingetragen werden. Bewährt hat sich dabei, solche Anmerkungen am
oberen Rand zu wiederholen, so dass sie schon vor dem Einzählen mit einem Blick
erfasst werden können. Beispiele hierfür sind "mit Sänger Chorus 3x", "Breaks
nur in Soli" oder "Banjosolo nach Gesang". Auch wenn der Banjoist fließend Noten
lesen kann ist es eine schöne Geste gegenüber der Aushilfe, die Akkordsymbole
über die Notenlinien zu schreiben. Ein Tipp noch an den Bandleader: das
Notenmaterial sollte immer doppelt vorhanden sein, einmal beim Musiker und als
Duplikat beim Leiter. So kann im Notfall sogar am Veranstaltungsort noch ein
Ersatzmusiker besorgt werden. Es versteht sich, dass auch das Duplikat den
aktuellen Stand der Arrangements wiedergeben sollte. Nebenstehendes Beispiel,
das neben guten Augen auch eine gehörige Portion Scharfsinn erfordert, fand ich
ausgerechnet in der Mappe von Paul Whitemans Banjo-Star Michael Pingitore.
Als
Bandmusiker steht man nicht alleine. Auch die Aushilfen sind auf Noten
angewiesen, mehr noch als der Stammspieler, sie sehen das Stück vielleicht zum
ersten Mal und müssen es quasi vom Blatt spielen. Ein paar Dinge gehören daher
einfach zum guten Ton, schließlich sind wir ja auch Aushilfe in anderen
Orchestern. Dazu zählt in erster Linie, dass alle Abweichungen in die
Notenblätter eingetragen werden. Bewährt hat sich dabei, solche Anmerkungen am
oberen Rand zu wiederholen, so dass sie schon vor dem Einzählen mit einem Blick
erfasst werden können. Beispiele hierfür sind "mit Sänger Chorus 3x", "Breaks
nur in Soli" oder "Banjosolo nach Gesang". Auch wenn der Banjoist fließend Noten
lesen kann ist es eine schöne Geste gegenüber der Aushilfe, die Akkordsymbole
über die Notenlinien zu schreiben. Ein Tipp noch an den Bandleader: das
Notenmaterial sollte immer doppelt vorhanden sein, einmal beim Musiker und als
Duplikat beim Leiter. So kann im Notfall sogar am Veranstaltungsort noch ein
Ersatzmusiker besorgt werden. Es versteht sich, dass auch das Duplikat den
aktuellen Stand der Arrangements wiedergeben sollte. Nebenstehendes Beispiel,
das neben guten Augen auch eine gehörige Portion Scharfsinn erfordert, fand ich
ausgerechnet in der Mappe von Paul Whitemans Banjo-Star Michael Pingitore.
![]() Dass
sich authentisches Notenmaterial aus den 20er Jahren nicht mehr im Musikladen um
die Ecke findet, dürfte einleuchten. Trotzdem liegt das Gute näher als man
denkt. Das Münchner Odeon Tanzorchester beispielsweise verdankt seine Entstehung
letztlich dem Entrümpeln eines Dachbodens, was das Notenmaterial eines längst
vergangenen Tanzorchesters zu Tage förderte. Daneben sind auch Musikantiquariate
ab und zu einen Besuch wert, selbst wenn ein Fund hier eher die Ausnahme ist.
Wer das Zeug nicht sammeln sondern nur spielen will, ist natürlich mit Kopien
bestens bedient. Die gibt es bei vielen Sammlern und befreundeten Orchestern zum
Selbstkostenpreis oder im Tausch gegen eigenes Material.
Dass
sich authentisches Notenmaterial aus den 20er Jahren nicht mehr im Musikladen um
die Ecke findet, dürfte einleuchten. Trotzdem liegt das Gute näher als man
denkt. Das Münchner Odeon Tanzorchester beispielsweise verdankt seine Entstehung
letztlich dem Entrümpeln eines Dachbodens, was das Notenmaterial eines längst
vergangenen Tanzorchesters zu Tage förderte. Daneben sind auch Musikantiquariate
ab und zu einen Besuch wert, selbst wenn ein Fund hier eher die Ausnahme ist.
Wer das Zeug nicht sammeln sondern nur spielen will, ist natürlich mit Kopien
bestens bedient. Die gibt es bei vielen Sammlern und befreundeten Orchestern zum
Selbstkostenpreis oder im Tausch gegen eigenes Material.
![]() Wer
auf der Suche nach selteneren Exemplaren ist, wird vielleicht in Museen oder
Stiftungen fündig. Allerdings wird’s hier gleich offiziell. Auch heute noch
gehören die Aufführungsrechte der Stücke irgendwelchen Verlagen und man braucht
deren schriftliche Einwilligung, ehe das Museum eine Kopie rausrückt. Unser
Schriftwechsel mit diversen Verlagen und der Whiteman Stiftung am Williams
College dauerte ein ganzes Jahr, ehe wir Kopien der handschriftlichen
Originalarrangements des Paul Whiteman Orchesters von 1927 in Händen hielten.
Wer
auf der Suche nach selteneren Exemplaren ist, wird vielleicht in Museen oder
Stiftungen fündig. Allerdings wird’s hier gleich offiziell. Auch heute noch
gehören die Aufführungsrechte der Stücke irgendwelchen Verlagen und man braucht
deren schriftliche Einwilligung, ehe das Museum eine Kopie rausrückt. Unser
Schriftwechsel mit diversen Verlagen und der Whiteman Stiftung am Williams
College dauerte ein ganzes Jahr, ehe wir Kopien der handschriftlichen
Originalarrangements des Paul Whiteman Orchesters von 1927 in Händen hielten.
![]() Ich
hatte oben empfohlen, die Originalnoten vor dem
Kopieren zu entflecken und alle Eintragungen zu entfernen. Das gilt unter echten
Sammlern natürlich als ungeheurer Frevel. Gerade handschriftliche Eintragungen,
möglichst noch mit Bezug auf bekannte Musiker oder Orchester können den Wert
eher steigern. Selbst auf unseren Kopien wirkt der Vermerk "Mr. Beiderbecke" am
oberen Rand eines Whiteman-Arrangements noch Ehrfurcht gebietend. Und das "Mike"
auf meinen Banjonoten zu Side by Side braucht auch kein Tipp-Ex zu
befürchten. Dieses Beispiel zeigt übrigens, dass sogar Max Farley, immerhin
einer der Arrangeure des Paul Whiteman Orchesters, ganz ungeniert Teile fertiger
Stock-Arrangements einsetzte; die brauchbaren Passagen wurden einfach auf das
Notenblatt geklebt:
Ich
hatte oben empfohlen, die Originalnoten vor dem
Kopieren zu entflecken und alle Eintragungen zu entfernen. Das gilt unter echten
Sammlern natürlich als ungeheurer Frevel. Gerade handschriftliche Eintragungen,
möglichst noch mit Bezug auf bekannte Musiker oder Orchester können den Wert
eher steigern. Selbst auf unseren Kopien wirkt der Vermerk "Mr. Beiderbecke" am
oberen Rand eines Whiteman-Arrangements noch Ehrfurcht gebietend. Und das "Mike"
auf meinen Banjonoten zu Side by Side braucht auch kein Tipp-Ex zu
befürchten. Dieses Beispiel zeigt übrigens, dass sogar Max Farley, immerhin
einer der Arrangeure des Paul Whiteman Orchesters, ganz ungeniert Teile fertiger
Stock-Arrangements einsetzte; die brauchbaren Passagen wurden einfach auf das
Notenblatt geklebt:

![]() Erfreulicherweise
gibt es mittlerweile zahlreiche Orchester, die "sich zum Ziel gesetzt haben,
diese alten Schätze wieder zum Klingen zu bringen" (Auszug aus einem
Werbepamphlet). Es sind sogar so viele, dass meine Liste mit Sicherheit völlig
unzureichend ist. (Ich bin für jeden Hinweis auf andere Orchester dieses Genres
dankbar:
Erfreulicherweise
gibt es mittlerweile zahlreiche Orchester, die "sich zum Ziel gesetzt haben,
diese alten Schätze wieder zum Klingen zu bringen" (Auszug aus einem
Werbepamphlet). Es sind sogar so viele, dass meine Liste mit Sicherheit völlig
unzureichend ist. (Ich bin für jeden Hinweis auf andere Orchester dieses Genres
dankbar:
![]() )
)
Alleine im bairischen Raum sind das
Im restlichen Deutschland sind mir bekannt
In Europa tummeln sich
Aus Übersee grüßen
![]() Es
gibt eine ganze Menge Bücher zum Thema Jazz und Hot Dance Music. Ganz einfach
deshalb, weil alle großen Jazzmusiker jener Zeit sich in solchen Orchestern
ihren Lebensunterhalt verdienten. Man muss also nur noch die Biographien und
Diskographien der richtigen Musiker finden. Eine Rundreise zu den Buchläden der
näheren und ferneren Umgebung dürfte wenig zutage fördern, die meisten Bücher
sind in Amerikanisch. Ich habe meine Bücher daher fast alle im Versandhandel von
Norbert Rücker besorgt, der sich auf Jazzliteratur spezialisiert hat (Jazz
Records, Tel. 06082/688, der Mann verdient die Werbung!). Um euch die eigene
Auswahl zu erleichtern habe ich mal meine Bücher kurz charakterisiert:
Es
gibt eine ganze Menge Bücher zum Thema Jazz und Hot Dance Music. Ganz einfach
deshalb, weil alle großen Jazzmusiker jener Zeit sich in solchen Orchestern
ihren Lebensunterhalt verdienten. Man muss also nur noch die Biographien und
Diskographien der richtigen Musiker finden. Eine Rundreise zu den Buchläden der
näheren und ferneren Umgebung dürfte wenig zutage fördern, die meisten Bücher
sind in Amerikanisch. Ich habe meine Bücher daher fast alle im Versandhandel von
Norbert Rücker besorgt, der sich auf Jazzliteratur spezialisiert hat (Jazz
Records, Tel. 06082/688, der Mann verdient die Werbung!). Um euch die eigene
Auswahl zu erleichtern habe ich mal meine Bücher kurz charakterisiert:
| Titel | Autor | Inhalt |
|---|---|---|
| Swing that Music | Louis Armstrong | Autobiographie, geschrieben 1936. Auf sein Image bedacht, versucht Satchmo nachzuweisen, dass er schon immer Swing gespielt hat, worunter die Wahrheit gelegentlich leidet. |
| Tram; the Frank Trumbauer Story | Phil Evans, Larry Kiner, Bill Trumbauer | Biographie, zusammen mit Trams Sohn geschrieben, mit vielen Erinnerungen an Bix Beiderbecke und Paul Whiteman. Sehr teuer aber auch sehr wertvoll. |
| Pops; Paul Whiteman, King of Jazz | Thomas DeLong | Paul Whiteman und sein Traum, Jazz mit Klassik zu einer neuen amerikanischen Musik zu verbinden. Viele nette Details und Anekdoten, auch über die bei ihm beschäftigten Musiker. Unbedingt lesen! |
| American Musician in Germany, 1924 - 1939 | Danzi, Michael, as told to Rainer E. Lotz | Schön geschriebenes Buch über ein Musikerleben, das zum großen Teil im Berlin der Vorkriegsjahre spielt. |
| Jazz, wir nannten's Musik | Eddie Condon | Wie Eddie im Alleingang den Jazz salonfähig machte. Amüsant geschrieben, viele gute Sprüche. Das Original erfordert gute Amerikanisch-Kenntnisse |
| Chicago Jazz; a cultural history, 1904-1930 | William Howland Kenny | Hier ist nicht die
Musik das Thema sondern das soziologische und geographische Umfeld1. 1 Mit den bei Soziologen beliebten, zahlreichen Anmerkungen |
| Back Woods Jazz in the Twenties | Peg Meyer | Vom abenteuerlichen Leben völlig unbekannt gebliebener früher Jazzer in Missouri. Interessant, weil es damit irgendwie aus unserer Sicht geschrieben ist. |
| King Oliver | Walter Allen, Brian Rust, Laurie Wright | Eine genaue und vollständige Biographie von Oliver. Umfasst sogar die Identifizierung der Solisten in Olivers Aufnahmen und seine Tourneepläne. |
| Twenty years on wheels | Andy Kirk, as told to Amy Lee | Der schwarze Tubaspieler und Bandleader erzählt sein Leben und die Geschichte seiner Clouds of Joy. Interessant als Kontrast zu Biographien weißer Musiker. |
| Thirty years with the Big Bands | Arthur Rollini | Das Profileben eines typischen Bandmusikers, u.a. in den Orchestern von Benny Goodman und Paul Whiteman. |
| The wonderful era of the great dance bands | Leo Walker | Hier sind sie alle beieinander. Unglaublich viel Material und Fotos im Großformat. Ein Schnäppchen! |
| Negro Bands on Film, Vol. 1, Big Bands 1928 - 1950 | Dr. Klaus Stratemann | Zum Nachschauen, ob sich ein im Programm angekündigter Film aufzunehmen lohnt. Auch in idiotischen Liebesschnulzen verbirgt sich manch gute Jazzszene. |
| McKinneys Music | John Chilton | 68 Seiten Bio- Diskographie über McKinney's Cotton Pickers, 1928-1930 eine der fetzigsten Bands |
| Black Beauty, White Heat: A Pictorial History of Classic Jazz, 1920 - 1950 | Frank Driggs & Harris Lewine | Prachtvolle Sammlung alter Fotografien. Nicht nur die bekannten Gesichter, auch unzählige unbekannte Bands werden gezeigt, zusammen mit ihren Wirkungsstätten. Interessant auch die unterschiedlichen Sitzordnungen auf der Bühne. |
| Jazz Records, 1897 - 1942 | Brian Rust | Die Bibel für Jazz auf Schellacks. 2 Bände, knapp 2000 Seiten, das sagt alles. |
![]() Ich
hab's oben angedeutet, auch die alte Ballroom Musik ist im Internet vertreten.
Hier eine
Auswahl, die meisten mit Linklisten, die Zugang zu weiteren mit unserer
Musik verbundenen Themen wie Bands, Auktionen von 78er Platten, Sammler-Clubs,
usw. bieten:
Ich
hab's oben angedeutet, auch die alte Ballroom Musik ist im Internet vertreten.
Hier eine
Auswahl, die meisten mit Linklisten, die Zugang zu weiteren mit unserer
Musik verbundenen Themen wie Bands, Auktionen von 78er Platten, Sammler-Clubs,
usw. bieten: